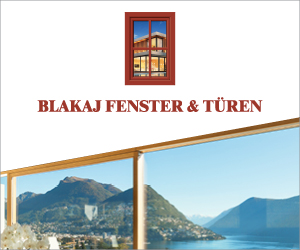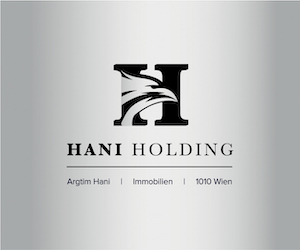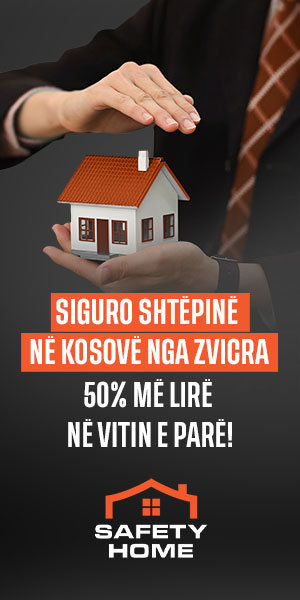Nachrichten
Jehona Kicajs Debütroman ” ë “: Der Flucht aus dem Ungesagten
Vor wenigen Minuten wurde der Deutsche Buchpreis an den Roman " Die Holländerinnen " der Schweizer Autorin Dorothee Elmiger verliehen. Jehona Kicaj stand auf der Shortlist.

Ihr Debütroman steht zu Recht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, die höchste Auszeichnung für Literatur in deutscher Sprache, schreibt DW.
Der Titel ihres ersten Romans ist ebenso ungewöhnlich wie beabsichtigt: „ë“ lautet sein Titel, ein im Albanischen wichtiger Buchstabe, auch wenn er nicht ausgesprochen wird, berichtet albinfo.ch. Dennoch verändert er die Betonung des Wortes, zu dem er hinzugefügt wird, schreibt die Autorin.
So hat das unausgesprochene „ë“ eine Wirkung. Und die Autorin Jehona Kicaj, 1991 im Kosovo geboren und in Deutschland aufgewachsen, erzählt von den Folgen und Wirkungen dessen, was unausgesprochen und ungehört bleibt.
Die renommierte Zeitung „Frankfurter Rundschau“ beschäftigt sich mit dem besonderen Titel des Romans „ë“. „Nominiert für den Deutschen Buchpreis: Der herausragende Debütroman von Jehona Kicaj ‘ë’ entsteht ganz aus Unsicherheit und Sprache. Das Geheimnis des kürzesten (deutschen) Romantitels des Jahres und in gewisser Weise der Welt – wird erst am Ende des Buches gelüftet. Der Buchstabe ë, wie der Erzähler einem neugierigen Freund erklärt, wird im Albanischen nicht ausgesprochen, verändert aber die phonetische Umgebung. Dass das Ausgelassene dennoch vorhanden ist und Folgen hat, wirkt fast zu stark, zu sichtbar.“
In ihrem Roman, der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht (der heute, am 13. Oktober, verliehen wird), untersucht Kicaj die Ereignisse des Kosovokrieges 1998/99, das Schweigen, das ihn umgibt, und den Schmerz derjenigen, die den Krieg selbst erlebt haben, ebenso wie derer, die ihn aus der Diaspora wahrgenommen haben. Sie erzählt die Geschichte aus der Perspektive ihrer namenlosen Ich-Erzählerin, die als kleines Kind Anfang der 1990er Jahre mit ihrer albanischen Familie aus dem Kosovo nach Deutschland floh. In der Gegenwart hat sie gerade ihre Ausbildung zur Lehrerin abgeschlossen.
Der Roman beginnt mit einer Szene beim Zahnarzt. Die Erzählerin leidet an Bruxismus, einer extremen Kieferanspannung, und der Arzt prophezeit ihr eine mögliche spätere Sprachunfähigkeit. An jenem Morgen: „Ich habe einen Splitter im Mund. Ich spucke ihn ins Waschbecken und sehe: Es ist ein kleines Stück Zahn. Jeden Morgen wache ich mit Schmerzen in den Kiefergelenken und im Nacken auf; ich kann den Mund nicht öffnen, ohne ein lautes Knacken zu hören. Es klingt, als würden Knochen brechen.“
Wie klug dieser Einstieg gewählt ist und wie sich die zentralen Themen und Motive hier andeuten, wird im weiteren Lesen deutlich. Die sich steigernde körperliche Schlaflosigkeit entspricht jener, die aus Trauma und Unterdrückung entsteht.
Kicaj untersucht viele Formen von Schlaflosigkeit und Schweigen, und wieder ist es der Körper, der spricht, wenn die verbale Sprache versagt. So erfahren wir, wie Knochen sprechen. Und natürlich ist die enorme Anspannung der Erzählerin Ausdruck von etwas, das sie tief beschäftigt.
In Rückblenden, Erinnerungen, die nicht chronologisch erzählt, sondern assoziativ verknüpft und fragmentarisch gestaltet sind, entfaltet Kicaj die Kindheit, Jugend und Gegenwart ihrer Erzählerin. „Ich wünschte, mein Schweigen machte mich unsichtbar“, teils, weil die deutsche Umgebung oft unsensibel reagiert; etwa, wenn ein Lehrer sie bittet, über die Kriegserlebnisse ihrer Verwandten im Kosovo zu sprechen.
Vertraut mit dem Schweigen
Das Mädchen ist mit dem Schweigen vertraut, denn die albanische Sprache war an der serbischen Grenze gefährlich. Das Weinen der Mutter während der Telefonate mit Verwandten im Kosovo und ihr Schweigen danach, ihr seltenes Sprechen. Das Schweigen der Familie nach dem Krieg über ihren verschwundenen Großvater, den sie spüren, aber nicht zu fragen wagen.
Die Autorin verwebt mühelos verschiedene Zeitebenen. In der Gegenwart besucht die Erzählerin Vorlesungen eines Gerichtsmediziners, Dr. Korner, der Leichen von Vermissten aus Massengräbern im Kosovo geborgen und ihre Identitäten sowie Todesumstände anhand der Skelette rekonstruiert hat.
Das Schweigen der Toten ist endgültig, doch „im Grunde sind wir Übersetzer der Sprache des Skeletts“, sagt Dr. Korner über seine Arbeit. Knochen sprechen, sie schreien sogar. Er betont die besondere Bedeutung von Zahnprothesen, die so einzigartig sind wie ein Fingerabdruck.
Diese Passagen haben eine große Intensität. Das Leiden der Individuen wird sichtbar. Ihre Würde wiederherzustellen und den Angehörigen das Trauern zu ermöglichen diese Anliegen werden spürbar. Doch dahinter steht auch das Ziel, die Täter nicht ungestraft davonkommen zu lassen.
Kicaj verknüpft feinfühlig die Metaebene mit der Familiengeschichte der Erzählerin durch das Motiv der Glasmurmeln, mit denen Kinder spielen: jene, die Dr. Korner bei einem toten Jungen findet, führen zu denen des überlebenden Cousins und von dort zurück zu den größeren Ereignissen des Krieges. Es ist ein Beispiel für das dichte und klug verwobene Geflecht des Textes, wie Motive sich spiegeln und in neuen Zusammenhängen wiederkehren.
Der gesamte Text verbindet eindrucksvoll das Persönliche mit den überindividuellen Aspekten des Krieges und vermittelt zugleich Erkenntnis. Kicaj integriert dies meisterhaft in den Erzählfluss: die von serbischen Einheiten gegen die albanische Zivilbevölkerung verübten Verbrechen, ihre Brutalität, die gesellschaftlichen Bedingungen vor und nach dem Krieg sowie die Intervention der NATO.
Der Ton der Erzählerin ist meist fast sachlich. Doch ihre Gefühle scheinen in einzelnen Aspekten verstreut. Sie äußern sich in klaren Sätzen: „Ich komme aus einem zerstörten Land. Ich wurde in einem verbrannten Haus geboren. Ich hörte Wiegenlieder in einer unterdrückten Sprache. Ich komme aus der Sprachlosigkeit.“
Jehona Kicajs beeindruckendes Debüt findet einen Ausweg aus dieser „Sprachlosigkeit“ und stellt sich dem Vergessen entgegen.
Weitere aus Nachrichten
E-Diaspora
-
 Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut...
Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut... -
 Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes”
Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes” -
 Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum.
Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum. -
 Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert.
Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert. -
 Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.
Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.
Leben in Österreich
-
 „In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen...
„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen... -
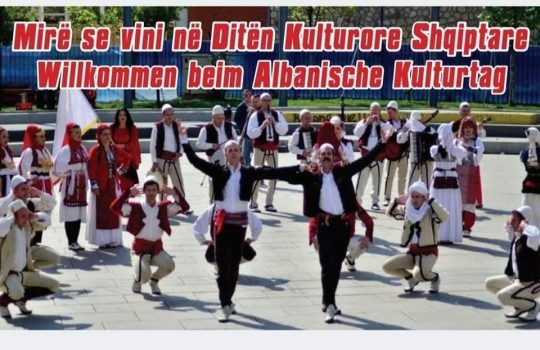 Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September.
Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September. -
 Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra.
Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra. -
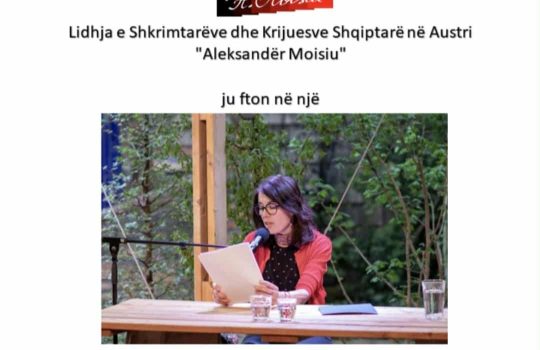 Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill
Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill -
 Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.
Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.